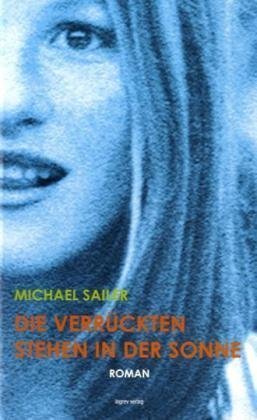 Ich bin als Redner ein erbärmlicher Versager, auch wenn das kokett klingen mag. Daher wäre es wohl besser, ich würde einfach ein bißchen lesen und den Rest Ihnen überlassen, wie sich das für einen Schriftsteller gehört. Ich möchte aber die seltene Gelegenheit, daß Sie nicht allein sind mit einem Buch, doch nützen und Ihnen in kurzen Worten erklären, warum ich das geschrieben habe.
Ich bin als Redner ein erbärmlicher Versager, auch wenn das kokett klingen mag. Daher wäre es wohl besser, ich würde einfach ein bißchen lesen und den Rest Ihnen überlassen, wie sich das für einen Schriftsteller gehört. Ich möchte aber die seltene Gelegenheit, daß Sie nicht allein sind mit einem Buch, doch nützen und Ihnen in kurzen Worten erklären, warum ich das geschrieben habe.
Zunächst eine ganz banale Sache, die jeder weiß und an die sich im entscheidenden Augenblick niemand erinnert: Selbstverständlich bin ich nicht der, der da erzählt. Ich bin vielleicht noch nicht einmal der, der die Selbsterzählung des Erzählers wieder- und weitergibt. Vielleicht bin ich gar nichts in dieser Geschichte, die aber freilich dennoch viele Sachen enthält, die ähnlich tatsächlich passiert sind. Was man nicht kennt, davon kann man nicht erzählen, das wissen wir alle, auch wenn Sie als Anhänger diverser Realismus- oder Science-Fiction-Schulen energisch widersprechen werden.
Natürlich ist es auch nicht meine Sprache, in der der Erzähler da erzählt. Wenn Sie sich bis hierher Sorgen um mich gemacht haben – der arme Kerl, wie wird es ihm gehen, wenn er nun jahrzehntelang Romane schreiben muß mit Dialogen wie diesen: ich, und sie, und wieder ich, und dann er, ich, und sie – nein, das steht bestimmt nicht zu befürchten. Dahinter könnte man einen billigen Trick vermuten, etwa daß ich mich an ein bestimmtes Publikum anbiedern wolle, indem ich seine Sprache imitiere. Der Autor, könnte man loben, trifft den Tonfall seiner Generation punktgenau, aber gehört er dieser Generation überhaupt an?
Ich will diese Kontroverse nicht führen. Es wird Sie erstaunen, wenn Sie nach (oder vor) diesem Roman andere Sachen von mir lesen, daß da ein ganz anderer Tonfall herrscht. Es ist wirklich so: Ich hielt diese Sprache für die einzige, in der die Geschichte erzählt werden kann. Freilich weiß ich auch, daß es für einen Schriftsteller gut und richtig ist, eine eigene Stimme, einen eigenen Tonfall zu entwickeln, der wiedererkennbar ist.
Zu seinem Stil finden, so nennt man das wohl. Wer heute schreibt wie Anzengruber und morgen wie Hemingway (ohne daß ich mich damit meinte), der hat auf dem heutigen Buchmarkt nichts zu lachen. Egal wie viele Leute sein erstes Buch und wie viele sein zweites Buch lieben, niemand wird das dritte kaufen, weil es schon gar niemand veröffentlichen wird. Man verlangt keinen neuen Müller, um dann einen neuen Maier zu bekommen.
Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich mich dieser Grundregel gerne widersetzen. Ich meine, daß auch eine Geschichte, nicht nur ihr Autor, einen bestimmten Tonfall hat. Außerdem besteht meines Erachtens in nächster Zeit nicht die Gefahr, daß Buchhandlungen von lautstarken Rufen nach »dem neuen Sailer« widerhallen. Ich bin also in der glücklichen Lage, »meinen Stil« (noch?) gar nicht finden zu müssen.
Im übrigen habe ich den Roman inzwischen leider fertiggeschrieben, was es mir unmöglich macht, über ihn ernsthaft nachzudenken. Ohne Ihnen oder irgend einem Kollegen zu nahe treten zu wollen, halte ich Literatur für einen Ausscheidungsprozeß: Was draußen ist, ist draußen. Wer sich auf der Toilette umdreht und bückt, tut dies hoffentlich nur auf Geheiß seines Arztes, und mir hat, was meine Geschichten angeht, ein solcher nicht dazu geraten, weil ich keinen konsultiert habe.
Mein liebster Autor war einst der Meinung, nun alles geschrieben zu haben, was er schreiben wollte, und tatsächlich hat er nie wieder etwas veröffentlicht. Ich werde nicht so weit gehen. Nur so weit: »Die Verrückten stehen in der Sonne« ist fertig, hinter mir und hoffentlich bald vor Ihnen, ich möchte und mache inzwischen anderes.
Ich könnte Ihnen als nächstes erklären, warum ich einen Roman über die achtziger Jahre geschrieben habe. Es ist nämlich so, daß …
Aber Sie haben mich wahrscheinlich durchschaut: Ich habe gar keinen Roman über die achtziger Jahre geschrieben. Was dann? Eine Liebesgeschichte? Ich weiß nicht. Einen Entwicklungsroman? Kaum. In den achtziger Jahren hat man sich nicht entwickelt, nur der Kontostand. Da beißt sich meine Erklärung in den Schwanz.
Vielleicht werde ich daher nun doch besser schweigen und lesen.
(Anmerkung: Dieser Entwurf einer Dankesrede entstand im Spätsommer 1998, also vor ziemlich genau sechsundzwanzig Jahren. Ich war damals gerade von einer Art Hochzeitsreise zurückgekehrt und hatte per Brief erfahren, daß mir das Kulturreferat der Stadt München ein Literaturstipendium zuerkannt hatte.
Das war lustig, weil ich damit absolut nicht gerechnet hatte. Und zwar deswegen: Ich hatte mich in den Jahren zuvor mehrere Male für dieses Stipendium beworben, mit Texten, die ich (!) für ambitioniert hielt, und war jedesmal durchgefallen. Zweimal besuchte ich hinterher die Lesungen der ausgewählten Stipendiaten und war entsetzt über die mindere, teilweise haarsträubend geringe Qualität ihrer Arbeiten (ein paar gute waren auch dabei).
Daß ich 1998 ein paar besonders krasse Passagen aus meinem Roman „Die Verrückten stehen in der Sonne“ als erneute Bewerbung einschickte, geschah aus einer Mischung von Pflichtgefühl und Trotz: Ich glaubte zu wissen, daß so etwas vom damals noch nicht vollständig gleichgeschalteten, aber notorisch biederen und oberschichtigen Literaturbetrieb unter keinen Umständen als auszeichnungswürdig befunden werden konnte.
So kann man sich ausnahmsweise irren. Hinterher erfuhr ich, daß ein einziger der Juroren, der heldenhafte und bewunderungswürdige Klaus Siblewski vom Luchterhand-Verlag, meinen Roman gegen den entschiedenen Widerstand der übrigen Jurymitglieder durchgesetzt hatte, wofür ich ihm bis heute dankbar bin. Leider gelang es ihm hinterher nicht, das Buch auch in seinem eigenen Verlag durchzusetzen. Circa zweihundert andere Verlage, denen ich den Roman zusandte, antworteten nur sehr sporadisch und dann aber vehement ablehnend. Die endgültige Antwort vom Maro-Verlag steht bis heute aus; man liest dort wohl recht langsam oder wägt sehr geduldig ab.
Das Buch erschien dann doch noch: 2010 im Lagrev-Verlag, dessen Leiter Jörg Steinleitner sich damit dafür bedankte, daß ich ihm meine Geschichtenreihe „Schwabinger Krawall“ für drei recht erfolgreiche Bände überlassen hatte. Auch diese hatte zuvor niemand auf diesem Planeten drucken wollen. Auch ihm bin ich sehr dankbar.
Im Buchhandel ist der Roman wahrscheinlich nicht mehr leicht zu kriegen. Vor sechs Jahren habe ich bei einem notorischen Online-Händler ein gebrauchtes Exemplar gekauft, das mir aus Prag zugeschickt wurde. Vielleicht erlaube ich mir bei Gelegenheit eine Neuauflage, falls daran irgendein Interesse besteht. Ich mag den Roman immer noch und würde kaum etwas daran ändern, wenn ich ihn heute schreiben müßte.
Bei der Veranstaltung zur Feier der Stipendiaten, bei der der damalige Kulturreferant Julian Nida-Rümelin eine Laudatio hielt, wurde ich gebeten, eine bestimmte Passage aus dem Buch nicht zu lesen. Selbstverständlich habe ich genau diese Passage gelesen.)

Ich subskribiere.