Ungefähr heute vor zwanzig Jahren wurde eine meiner Lieblingsbands gegründet, im Sommer 2005 erschien ihr erstes Album, das leider niemand mehr kennt, weil es wohl siebzehn Jahre zu früh kam. Ich schrieb damals (für KONKRET) folgendes dazu:
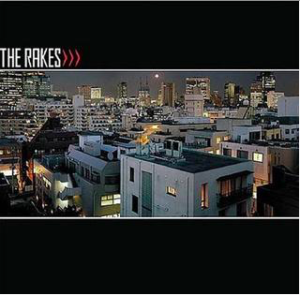 Was „Flexibilität und „Reformfähigkeit“, die Hinnahme „schmerzhafter Einschnitte“ und die Bereitschaft zur gegenleistungslosen Steigerung der eigenen Produktivität und Hinnahme der völligen Durchdringung des Privatlebens von ökonomischen Strukturen angeht, sind die Briten, so hört man, den Deutschen ein paar Nasenlängen voraus.
Was „Flexibilität und „Reformfähigkeit“, die Hinnahme „schmerzhafter Einschnitte“ und die Bereitschaft zur gegenleistungslosen Steigerung der eigenen Produktivität und Hinnahme der völligen Durchdringung des Privatlebens von ökonomischen Strukturen angeht, sind die Briten, so hört man, den Deutschen ein paar Nasenlängen voraus.
Man mag das so oder so sehen, aber es ist wohl was Wahres dran; wer exzessive Ausbeutung bei gleichzeitiger exzessiver Selbstausbeutung mittels komprimierter Freizeitnutzung von Hooliganismus bis „binge drinking“ in einer hypermodernen Klassengesellschaft studieren möchte, schlägt sein Beobachtungscamp am besten in London auf. Nirgendwo sonst gibt es so viele scheinbar normale, optimistische, aufbruchsbereite Tätige, die abseits des Jobs in einem Ausmaß Drogen konsumieren, das sich echte Junkies finanziell gar nicht leisten können, sich dann am nächsten Morgen mit verkaterten Lächeln über dem weißen Hemd in die U-Bahn quetschen, die ihnen jederzeit um die Ohren fliegen könnte.
Nirgendwo sind die Gegensätze so schroff, die Abgründe so tief und werden so stur ignoriert. Hier gibt es seit Mitte der achtziger Jahre dank Frau Thatcher keine mächtigen oder auch nur wichtigen Gewerkschaften mehr, von anderem sozialen Firlefanz zu schweigen. Wer arbeiten darf, der schuftet und hält das Maul, und solange die U-Bahn nicht explodiert und irgendwer in den frühen Morgenstunden die Kotze von den Bürgersteigen spült, geht alles fine und nice so weiter.
Wie erzählt man diesen zwanghaften Wahnsinn, dieses moderne Leben zwischen Büroraserei, fettigem Schnellfraß, glitzerndem Schnickschnack, kollektiver Abfüllung und dem Elend der allem explodierenden Amusement inhärenten Einsamkeit und Verzweiflung, dem Nichts als Endstation, als Ziel, wo keiner hinwill und jeder landet, in Form von Popsongs, also in einer Form, die selbst eines der zentralen Bestandteile des Phänomens ist? Vielleicht einfach so: „I just drift along with no focus or meaning.“
Man könnte das, was Alan Donahue da (in einem Song, dessen Titel als Kurzgedicht durchginge und zumindest alles schon mal sagt: „Work, Work, Work, (Pub, Club, Sleep)“ singt, romantischen Zynismus nennen, weil er liebt, was ihn ankotzt, weil er die Dinge durchschaut, auf die er hereinfällt, weil ihm nichts geblieben ist von Naivität, Schwärmerei, Träumen und er doch gleichzeitig dermaßen naiv träumt und schwärmt, daß es für seine heroische Ostblock-Befreiungsgeschichte „Strasbourg“ gar keine Rolle spielt, daß die titelgebende Stadt im Oktober 1983 ganz bestimmt nicht in „West Germany“ lag.
Letzteres übrigens ist derzeit einer der populärsten Bezugspunkte in der britischen und anglophilen Popmusik: Kaum eine junge Band kommt ohne deutsche Textzeile, deutschen Songtitel aus (Franz Ferdinand: „Auf Achse“, The Libertines: „Arbeit macht frei“ usw.). The Rakes haben einen Song mit dem Titel „Ausland-Mission“ (hier nicht drauf), sie zitieren in „22 Grand Job“ Trios „Da Da Da“ ebenso frech nebenbei, wie Bloc Party (klar: „Blockpartei“, deren Sänger Kele Okereke wiederum von Donahue in „The Guilt“ stimmlich zitiert wird) den „Eisbär“ von Grauzone zitiert haben. „Eins zwei drei vier!“ schreit der Rakes-Sänger in „Strasbourg“, und: „Dann sind wir Helden!“
Der in seinen Texten immer wieder grell aufblitzende Witz macht es schwer, seinen Revolutionsheroismus für bare Münze zu nehmen, aber hier gelingt es: „Ideas can change the government / But they never listen to our arguments / On TV our friends smashed cement / Pulled down the bastards’ monument“ – da möchte man bei ausreichender Lautstärke am liebsten losrennen und selber irgendwas zertrümmern, egal was danach kommt und ob die Flucht gelingt („surveilance cameras capture dawn / breaking on the Autobahn“). Am Ende bleibt sowieso nur die Wodkafahne der Geliebten.
An eine Jahrhundertsingle wie „Strasbourg“ (vor genau einem Jahr erschienen) ein Rest-Album dranzuhängen, ist die schwerste Aufgabe, die man sich für eine junge Popband vorstellen kann (vielleicht hat es deshalb so lange gedauert). Zum Glück haben The Rakes der Versuchung widerstanden, das Rezept noch zehnmal nachzukochen. Der Rest der Platte ist anders, aber keinen Deut schwächer – roh, knochentrocken, fast effektfrei, über weite Strecken scheinbar nüchtern und kühl dargebracht, elektrisch geladen wie rare Höhepunkte der späten New Wave (mal könnte man an Tubeway Army denken, mal an die Buzzcocks, an Gang of Four ohne Funk, sogar an The Specials und die „Sandinista“-Clash und ganz besonders an Wire), dabei aber bebend vor untergründigem Zorn, Frustration und Ironie, die sich nur noch stellenweise katastrophisch-achterbahnmäßig entladen, etwa in der „The Guilt“-Zeile „I just woke up / Everything was fucked“.
Der Rest ist Einsicht und Ergebung: Wir sind alle Tiere, haben ein paar Zähne, Haare und Instinkte verloren, sie eingetauscht gegen Auswahl und Angebot. Maschinen mit Genen, die man verschrottet, wenn die Arbeit getan, der Wert abgeschöpft ist. „22 grand job / In the city that’s alright / If the money is right.“
Alles wiederholt sich, läuft im Kreis, ohne Anhaltspunkt, abgesehen von Bars, fremden Betten, der Verzweiflung beim Erwachen. Der Lohn ist Leere, die Erlösung Stille, dasitzen, an die Decke starren. In „Terror!“ fällt die ironische Maske endgültig; das ist der reale Horror: „And my job in the city won’t matter no more / When the network is down and my flesh is all torn.“ Wenn jedes Flugzeug eine Rakete, jeder Koffer eine Bombe ist, spielt es keine Rolle mehr, ob die Massenhysterie inszeniert ist. Es bleibt kein Platz für Vernunft, nur „fear in my bones“.
The Rakes – außer Donahue sind das Gitarrist Matthew Swinnerton (ein Witzbold, der schon mal einem Photographen anbietet, eine englische Fahne anzupinkeln, wenn sich kein besseres Motiv findet), Schlagzeuger Lasse Petersen (ein Metronom bester Wave-Schule) und Bassist Jamie Hornsmith (der auch äußerlich dem jungen Alex James von Blur ähnelt) – kommen aus der Whitechapel-Szene im Londoner East End, deren crack- und heroinverhagelten Treffpunkten (zuerst die Rhythm Factory, später das „Flophouse“, eine Bude über einem Imbißladen in der Hackney Road) im Sommer 2003 ein solcher Pulk von Bands entsproß, daß man aus dem Ohrenschlackern gar nicht mehr rauskam.
In deren Musik war das verkörpert: „no focus or meaning“ – aber liegt in einer solchen Selbstbeschreibung (die Ironie mal subtrahiert) nicht auch das freimütige Eingeständnis von Manipuliertheit, Verblödung, Teilnahme am großen Nichts der Raserei …? Könnte man meinen; aber es nützt ja auch nichts, etwas abzustreiten. Und im Gegensatz etwa zur „Exile On Main Street“-Selbstzerstörungs-Punkromantik der Libertines (bzw. Peter Dohertys Nachfolgeband Babyshambles, die sich derzeit öffentlich zerfetzt) und ganz besonders zur larmoyant unterfütterten Rebellionsrandale von Klassenkameraden wie The Others haben The Rakes nicht nur ein großes Herz, sondern auch ein großes Hirn.
Doch, die Briten sind ein paar Schritte weiter, nicht nur was den kapitalistischen Verbrennungsprozeß und seine Begleiterscheinung betrifft, sondern auch deren Reflexion in Popmusik. Das scheinbare Paradoxon, daß diese Musik und diese Texte wütend machen bis zur Handgreiflichkeit und zugleich einen derartigen Spaß, daß sie zum Grinsen und Schenkelklopfen zynisch-unverschämt, zum Schreien witzig und zugleich zum Schaudern eisig-melancholisch sind, das macht ihre Qualität aus.
