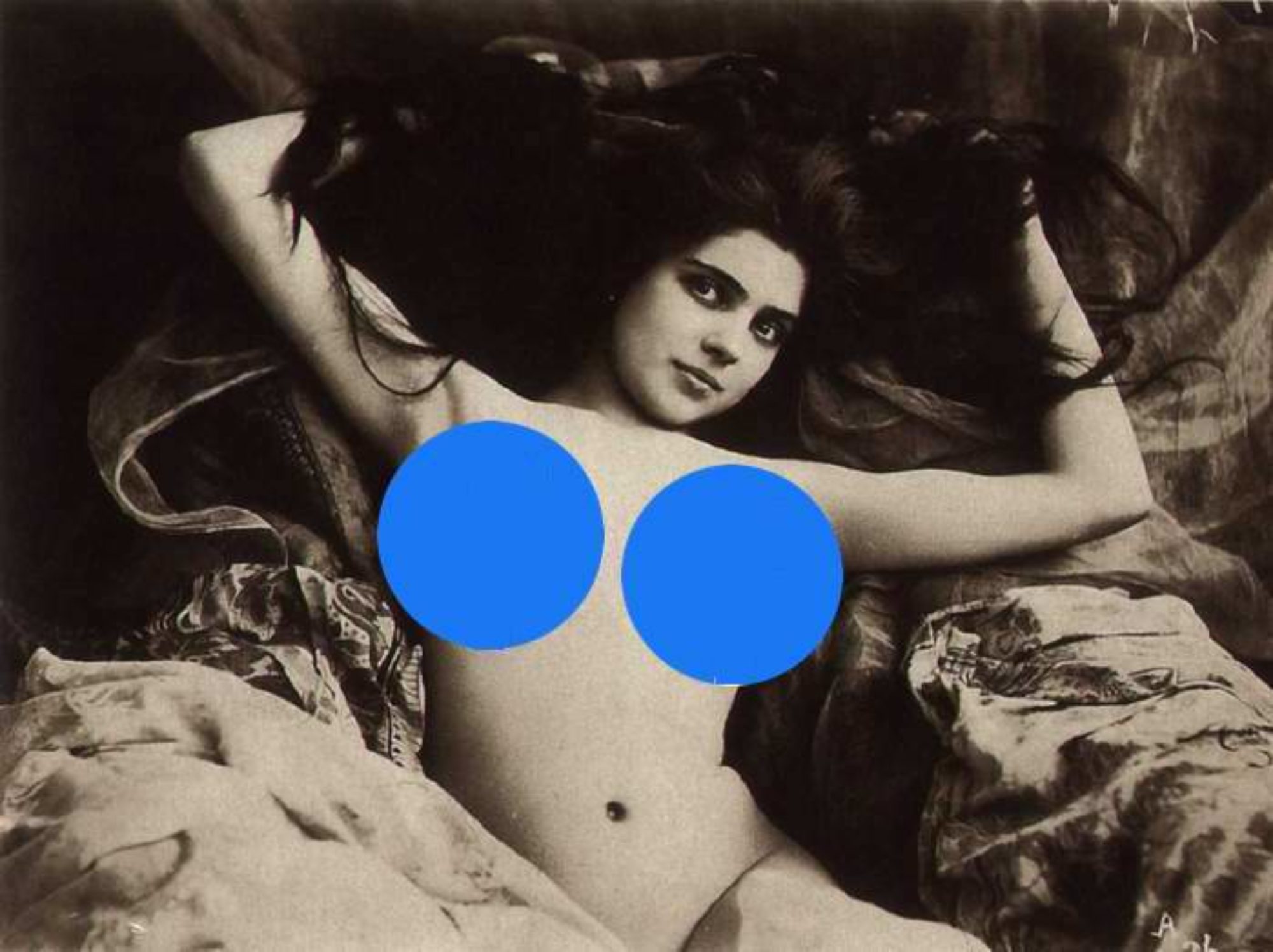Vielleicht erscheint es nur mir so, aber mir erscheint es so, als wäre der hundertste Geburtstag von Hank Williams im September 2023 ebenso unbemerkt vorübergegangen wie sein siebzigster Todestag im Jahr zuvor. Das mag man typisch finden oder (wie ich) nicht so wichtig. An den Mann und seine Musik denken und sie hören darf man aber schon hin und wieder.
(Der folgende Text entstand im Frühjahr 2002 für den Musikexpreß und ist dort in stark gekürzter Form erschienen. Ob die etwas unangemessene Überschrift dabei erhalten blieb, weiß ich nicht mehr.)
 Der Schneesturm, der seit Tagen im Südosten der USA wütet, wird kurz vor Silvester 1952 so heftig, daß bereits gestartete Flugzeuge zurückgeholt und alle weiteren Flüge gestrichen werden. Das widrige Wetter hat dem 19jährigen Charles Carr, der neben seinem Studium als Taxifahrer sein Geld verdient, einen Job als Chauffeur eingebracht: sein Fahrgast muß von Montgomery in Alabama durch West Virginia bis nach Canton, Ohio, wo er, nach einigen kleineren Gigs auf dem Weg, am Neujahrstag mit Hawkshaw Hawkins und Homer & Jethro auftreten soll. Der schlanke, blasse Mann neben Carr, dem der himmelblaue 52er Cadillac gehört, ist neunundzwanzig Jahre alt und einer der erfolgreichsten Popstars der USA. Und er ist, als Carr am 31. Dezember gegen Mitternacht bei Blaine in Tennessee von einem Polizisten angehalten wird, seit etwa zwei Stunden tot. Bis davon jemand etwas bemerkt, wird jedoch noch einige Zeit vergehen.
Der Schneesturm, der seit Tagen im Südosten der USA wütet, wird kurz vor Silvester 1952 so heftig, daß bereits gestartete Flugzeuge zurückgeholt und alle weiteren Flüge gestrichen werden. Das widrige Wetter hat dem 19jährigen Charles Carr, der neben seinem Studium als Taxifahrer sein Geld verdient, einen Job als Chauffeur eingebracht: sein Fahrgast muß von Montgomery in Alabama durch West Virginia bis nach Canton, Ohio, wo er, nach einigen kleineren Gigs auf dem Weg, am Neujahrstag mit Hawkshaw Hawkins und Homer & Jethro auftreten soll. Der schlanke, blasse Mann neben Carr, dem der himmelblaue 52er Cadillac gehört, ist neunundzwanzig Jahre alt und einer der erfolgreichsten Popstars der USA. Und er ist, als Carr am 31. Dezember gegen Mitternacht bei Blaine in Tennessee von einem Polizisten angehalten wird, seit etwa zwei Stunden tot. Bis davon jemand etwas bemerkt, wird jedoch noch einige Zeit vergehen.
1952 brachte Hank Williams nach drei Jahren sagenhaften Erfolgs und ununterbrochener Präsenz in den US-Single-Top-ten eine Kette von Rückschlägen und Abstürzen. Der Sänger, Gitarrist und Songwriter, von dem niemand genau sagen kann, wieviele Lieder er wirklich geschrieben hat – seine eigene Schätzung liegt bei fünfhundert –, hat sich im Januar von seiner Frau Audrey getrennt, die auch seine Managerin war und den gemeinsamen Sohn Randall Hank jr. nach der Scheidung bei sich behält. Seither ist die dunkle Seite in Williams, zuvor im Auge der Öffentlichkeit meist vom Erfolg überstrahlt, deutlicher als je zum Vorschein gekommen.
Der Sohn eines Weltkriegssoldaten, ohne Vater aufgewachsen und zeit seines Lebens infolge einer unbehandelt gebliebenen Rückenmarkskrankheit (Spina bifida occulta) von quälenden Schmerzen, mentalen Störungen und zunehmender Inkontinenz geplagt, hat, obwohl seine Platten nach wie vor gut laufen, im August wegen seiner notorischen Sauferei den mühsam erlangten Platz in der wichtigsten Country-Institution der USA, Nashvilles Grand Ole Opry, verloren und ist wieder dort gelandet, wo alles begann: auf der Straße, beim Tingeln von Club zu Club. Er will, er muß beweisen, daß er nicht am Ende ist, daß er den Dämon besiegen kann. Die Flasche Whiskey, die Hank dabei hat, ist in dieser Angelegenheit allerdings kein guter Begleiter.
 Der Polizist, der den Cadillac anhält, nachdem Carr ihn bei einem gewagten Überholmanöver beinahe frontal gerammt hätte, heißt Swan Kitts. Carr erklärt ihm, er müsse Hank Williams nach Ohio bringen; es sei Hanks erster Auftritt mit seinen alten Nashville-Kollegen seit Monaten, er dürfe sich auf keinen Fall verspäten. Kitts wirft einen Blick in den Cadillac, sieht den regungslosen Williams auf der Rückbank und fragt Carr, was mit ihm los sei: „Der Kerl sieht ja aus wie tot.“ Als er erfährt, daß Williams wegen seiner Rückenschmerzen eine Morphiumspritze bekommen und danach bei einem dreistündigen Zwischenhalt im Andrew Johnson Hotel in Knoxville ein paar Drinks genommen hat, läßt er ihn in Ruhe.
Der Polizist, der den Cadillac anhält, nachdem Carr ihn bei einem gewagten Überholmanöver beinahe frontal gerammt hätte, heißt Swan Kitts. Carr erklärt ihm, er müsse Hank Williams nach Ohio bringen; es sei Hanks erster Auftritt mit seinen alten Nashville-Kollegen seit Monaten, er dürfe sich auf keinen Fall verspäten. Kitts wirft einen Blick in den Cadillac, sieht den regungslosen Williams auf der Rückbank und fragt Carr, was mit ihm los sei: „Der Kerl sieht ja aus wie tot.“ Als er erfährt, daß Williams wegen seiner Rückenschmerzen eine Morphiumspritze bekommen und danach bei einem dreistündigen Zwischenhalt im Andrew Johnson Hotel in Knoxville ein paar Drinks genommen hat, läßt er ihn in Ruhe.
Carr folgt Kitts nach Rutledge, wo er wegen rücksichtslosen Fahrens eine Geldstrafe von fünfundzwanzig Dollar aufgebrummt bekommt. Gegen ein Uhr morgens fährt er weiter Richtung Canton.
 Auf der Geburtsurkunde stand ein falscher Name: „Hiriam“ Williams hieß in Wirklichkeit Hiram, aber auch dieser Name gefiel dem Jungen nicht, der am 17. September 1923 in einer Blockhütte nahe der Kleinstadt Georgiana, Gemeinde Mount Olive, im US-Südstaat Alabama zur Welt kam, und sobald er richtig sprechen konnte, nannte er sich Hank. Vielleicht auch um weitere Fehler zu vermeiden, denn richtig schreiben lernt Hank Williams sein Leben lang nicht. Hanks Eltern sind einfache Leute. Vater Elonzo „Lon“ Huble Williams ist Holzarbeiter, Mutter Jessie Lillybelle „Lilly“ Skipper Williams hütet Hank, seine zwei Jahre ältere Schwester Irene (ein zweiter Bruder ist kurz nach der Geburt gestorben) und das Haus, das nie lange dasselbe ist, weil Lons Job häufige Umzüge innerhalb von Alabama erzwingt. Hank ist vier Jahre alt, als sein Vater, der unter den Nachwirkungen eines Gasangriffs während seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg leidet, in ein Hospital für Veteranen eingeliefert wird; während der zehn Jahre, die er dort verbringt, läßt sich Lilly scheiden.
Auf der Geburtsurkunde stand ein falscher Name: „Hiriam“ Williams hieß in Wirklichkeit Hiram, aber auch dieser Name gefiel dem Jungen nicht, der am 17. September 1923 in einer Blockhütte nahe der Kleinstadt Georgiana, Gemeinde Mount Olive, im US-Südstaat Alabama zur Welt kam, und sobald er richtig sprechen konnte, nannte er sich Hank. Vielleicht auch um weitere Fehler zu vermeiden, denn richtig schreiben lernt Hank Williams sein Leben lang nicht. Hanks Eltern sind einfache Leute. Vater Elonzo „Lon“ Huble Williams ist Holzarbeiter, Mutter Jessie Lillybelle „Lilly“ Skipper Williams hütet Hank, seine zwei Jahre ältere Schwester Irene (ein zweiter Bruder ist kurz nach der Geburt gestorben) und das Haus, das nie lange dasselbe ist, weil Lons Job häufige Umzüge innerhalb von Alabama erzwingt. Hank ist vier Jahre alt, als sein Vater, der unter den Nachwirkungen eines Gasangriffs während seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg leidet, in ein Hospital für Veteranen eingeliefert wird; während der zehn Jahre, die er dort verbringt, läßt sich Lilly scheiden.
Als Hank sieben wird, bestellt ihm seine Mutter als Belohnung für gute Schulnoten bei dem Versandhaus Sears & Roebuck eine gebrauchte Gitarre für drei Dollar fünfzig, die sie in Raten von fünfzig Cents abbezahlt. Schon mit drei ist er neben ihr gesessen, wenn sie in der Baptistenkirche von Mount Olive die Orgel spielte. Sein erster Song, den er 1934 am Mittagstisch in der Greenville High School zu Gehör bringt, handelt, wie sich die Lehrerin Flora Heartsill erinnert, von einer Ziege, die Blechdosen frißt und dann Ford-Autos auf die Welt bringt.
Hanks Vorbild und Lehrer ist der schwarze Straßensänger Rufus Payne, der sich Tee-Tot nennt und dem das Kunststück gelingt, sein während der Depressionszeit fast restlos verarmtes Publikum dazu zu bringen, ihm die letzten Pennies in den Hut zu werfen. Auch Hank: „Ich putzte Schuhe, verkaufte Zeitungen und lief diesem alten Neger hinterher, damit er mir Gitarrespielen beibringt. Für eine Lektion gab ich ihm fünfzehn Cents oder was ich halt gerade hatte.“
Hank will keinen anderen Lehrer: „Mama, laß mich auf meine Weise spielen“, sagt er, als Lilly anbietet, ihm Musikstunden zu bezahlen. Von Tee-Tot lernt Hank nicht nur die wichtigsten Akkorde, sondern auch daß es wichtiger ist, die Leute mit Aufrichtigkeit zu fesseln, als ihnen mit musikalischer Brillanz imponieren zu wollen. Und nicht zuletzt infiziert er den Jungen mit einem schleichenden Blues-Virus, das Hank nie mehr loswerden wird. Das Leben tut sein Teil dazu: Eine Woche nach dem Einzug brennt das neue Haus der Familie in Georgiana nieder; Hank rettet nur ein Schlafanzugoberteil, seine Schwester die Hose dazu.
1937 zieht die Familie nach Montgomery, wo Lilly in der S. Perry Street eine kleine Pension eröffnet und sich als Managerin ihres Sohnes betätigt. Der gewinnt seinen ersten Talentwettbewerb und gründet seine erste Band, die Drifting Cowboys, die auch seine einzige bleiben wird, allerdings in dauernd wechselnder Besetzung. Die Alabama-Clubs der späten Dreißiger haben wenig mit heutigen Konzerthallen gemein, und so ist es naheliegend, daß Hank als Bassisten den ehemaligen Ringer Cannonball Nichols engagiert.
 Und obwohl er es schon bald zu einer gewissen lokalen Bekanntheit gebracht hat, ist seine Mutter mit Hanks Karriereeifer ebensowenig zufrieden wie Audrey Mae Sheppard, die er als Teilnehmer einer „Medicine Show“ kennenlernt und im Dezember 1944 heiratet. Ihr gelingt es, den Schüchternen zu einer Fahrt nach Nashville zu überreden, wo Hank am 14. September 1946 den Produzenten Fred Rose trifft. Gekannt hat Williams Rose schon vorher: Dessen Song „Death is Only a Dream“ bleibt für alle Zeiten sein Lieblingslied.
Und obwohl er es schon bald zu einer gewissen lokalen Bekanntheit gebracht hat, ist seine Mutter mit Hanks Karriereeifer ebensowenig zufrieden wie Audrey Mae Sheppard, die er als Teilnehmer einer „Medicine Show“ kennenlernt und im Dezember 1944 heiratet. Ihr gelingt es, den Schüchternen zu einer Fahrt nach Nashville zu überreden, wo Hank am 14. September 1946 den Produzenten Fred Rose trifft. Gekannt hat Williams Rose schon vorher: Dessen Song „Death is Only a Dream“ bleibt für alle Zeiten sein Lieblingslied.
Rose nimmt Hank unter Vertrag. Am 11. Dezember entstehen die ersten Aufnahmen für das kleine Label Sterling, dann verschafft Rose seinem Schützling einen Deal mit MGM und schickt ihn nach dem ermutigenden Erfolg der Single „Move It On Over“ 1948 mit dem „Louisiana Hayride“, einer prestigeträchtigen Radioshow und fahrenden Konkurrenz zur Grand Ole Opry, auf Tournee. Der Rest ist Musikgeschichte: 1949 nimmt Williams gegen Roses Rat Emmett Millers vierundzwanzig Jahre alten Jodler „Lovesick Blues“ neu auf – die Platte steht sechzehn Wochen lang auf Platz eins der US-Country-Charts, bleibt ein Jahr lang in den Hitlisten und ist der Anfang einer Hitserie, die drei Jahre lang anhält und dem Mann, der von sich sagt, er habe außer Songwriting keine Hobbies und sei nur daran interessiert, einfache, ehrliche Geschichten zu erzählen, ein Jahressalär von astronomischen 200.000 Dollar einbringt, ihn aber auch durch häufige Reisen von zu Hause und der Familie entfremdet.
 Immer öfter ertränkt Williams seinen Kummer, fällt von der Bühne, vergißt Texte oder taucht zu Konzerten erst gar nicht auf, bis ihn im Herbst 1952 auch seine Band und sein väterlicher Partner Fred Rose sitzenlassen. Im Oktober sagt er zu der neunzehnjährigen Polizistentochter Billie Jean Jones: „Wenn du noch nicht verheiratet bist, wird dich der alte Hank heiraten“ – der Traum vom neuen Familienglück ist von kurzer Dauer. Vielleicht hat er das Ende geahnt: Am 20. Dezember erscheint die Single „I’ll Never Get Out Of This World Alive“. Sie erreicht Platz eins der Billboard-Country-Charts, aber der Triumph kommt für Hank drei Tage zu spät.
Immer öfter ertränkt Williams seinen Kummer, fällt von der Bühne, vergißt Texte oder taucht zu Konzerten erst gar nicht auf, bis ihn im Herbst 1952 auch seine Band und sein väterlicher Partner Fred Rose sitzenlassen. Im Oktober sagt er zu der neunzehnjährigen Polizistentochter Billie Jean Jones: „Wenn du noch nicht verheiratet bist, wird dich der alte Hank heiraten“ – der Traum vom neuen Familienglück ist von kurzer Dauer. Vielleicht hat er das Ende geahnt: Am 20. Dezember erscheint die Single „I’ll Never Get Out Of This World Alive“. Sie erreicht Platz eins der Billboard-Country-Charts, aber der Triumph kommt für Hank drei Tage zu spät.
Irgendwann während der frühen Morgenstunden des Neujahrstages 1953 wird Charles Carr klar, daß mit seinem Fahrgast etwas nicht in Ordnung ist. Als er im Skyline Drive-In hält, um einen Kaffee zu trinken und sich die Füße zu vertreten, schüttelt er den Sänger, aber der reagiert nicht. Gegen halb sechs hält Carr an Burdette’s Pure Oil Station in Oak Hill, West Virginia und sagt, es gebe ein Problem. Die Tankwarte schicken ihn ins örtliche Krankenhaus, wo zwei Pfleger Hank Williams aus dem Wagen ziehen und in die Notaufnahme tragen. Dort wird um sieben Uhr morgens sein Tod festgestellt, der nach Schätzungen der Ärzte mindestens sechs Stunden zuvor eingetreten sein muß. Todesursache: Herzversagen.
Der Begräbnisunternehmer Joe Tyree, dem die Leiche überstellt wird, erinnerte sich später: „Wir haben eine Menge Williamses in der Gegend. Der Name Hank Williams sagte mir nichts, bis ich hörte, daß er ein Sänger aus dem Radio war. Aber was wirklich los war, ist mir erst aufgegangen, als die Telephone zu klingeln anfingen.“
 Wo und wann Hank Williams wirklich gestorben ist, wird sich nie mehr feststellen lassen. Zu seinem Begräbnis am 4. Januar strömt die größte Menschenmenge, die Montgomery je gesehen hat; obwohl die Trauerfeier ins City Auditorium verlegt wird, ist die Straße schwarz vor Menschen, die keinen Platz bekommen haben. Aber als Hank starb, war er wahrscheinlich der einsamste Mensch der Welt. „I’m so Lonesome I Could Cry“ heißt einer seiner größten Songs.
Wo und wann Hank Williams wirklich gestorben ist, wird sich nie mehr feststellen lassen. Zu seinem Begräbnis am 4. Januar strömt die größte Menschenmenge, die Montgomery je gesehen hat; obwohl die Trauerfeier ins City Auditorium verlegt wird, ist die Straße schwarz vor Menschen, die keinen Platz bekommen haben. Aber als Hank starb, war er wahrscheinlich der einsamste Mensch der Welt. „I’m so Lonesome I Could Cry“ heißt einer seiner größten Songs.
Es fehlt nicht an musikalischen und anderen Denkmälern für den Mann, der den Begriff „Country“ für alle Zeiten definierte, obwohl er selbst seine Musik als „Folk“ bezeichnete. 1997 wurde die Straße von Georgiana nach Montgomery in „Hank Williams Memorial Lost Highway“ umbenannt. Eine der schönsten Widmungen kam 1988 von Leonard Cohen, der sich mit „Tower of Song“ nicht nur erstmals an einem Blues versuchte, sondern auch deutlich machte, wo und wie Hank Williams weiterlebt: „Ich fragte Hank Williams: Wie einsam kann man werden? Hank Williams hat nicht geantwortet, aber ich höre ihn die ganze Nacht husten, hundert Stockwerke über mir im Turm der Lieder.“
Und dann ist da noch die Belegschaft des Andrew Johnson Hotels in Knoxville, die sich nicht von dem Glauben abbringen läßt, Hank Williams habe das Hotel in jener Silvesternacht gar nicht mehr verlassen. Immer mal wieder, so wird berichtet, ist nachts in den Gängen des Hotels seine leise, traurige Stimme zu hören, die „Death is Only a Dream“ singt.